


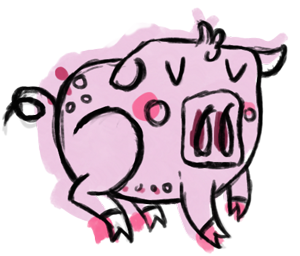

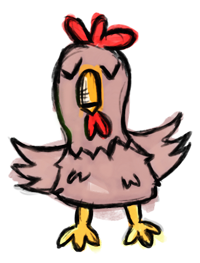
>> Aus dem Leben eines Schweines <<
Mein Name ist Penny. Heute habe ich das Licht der Welt erblickt. Wenn man das so nennen kann. Das Licht der Welt, die Sonne, ist nämlich nicht zu sehen. Aber dafür leuchtet ein rotes, warmes Licht. Ich habe insgesamt 13 Geschwister, glaube ich zumindest. Diese 13 sind mit mir zur Welt gekommen. Ob ich noch ältere Geschwister habe, weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich keine sehen. Bei unserer Mama bekommen wir immer total leckere Milch. Leider spielt sie nie mit uns. Sie bewegt sich auch nicht, sie liegt einfach nur am Boden, den ganzen Tag. Ich glaube, wegen der vielen Eisenstangen kann sie sich auch nicht viel bewegen, selbst wenn sie wollte. Warum die Stangen da sind, weiß ich nicht so genau. Die Milch ist zwar lecker, aber es ist nie genug davon da. Unsere Mama hat nur 12 Zitzen, wir sind aber 14 Ferkel. Deshalb geht immer mal wieder einer von uns leer aus.
Immer wieder kommt ein Mensch vorbei, die anderen nennen ihn nur „den Bauern“. Er sieht einmal kurz nach uns und wirft uns etwas Stroh zu. Dann verschwindet er wieder.
Heute ist mein zweiter Tag auf dieser Welt, ich wache auf. Es stinkt. Ich nutze die Zeit, um mit meinen Geschwistern zu spielen und sie besser kennen zu lernen. Meine Lieblingsgeschwister sind Chris und Sandy, mit ihnen spiele ich am liebsten. Chris ist ein kleiner Racker und Sandy total verspielt.
Tag 3: Ich wache auf. Und ich höre Schreie. Ich schaue mich um. Nicht weit entfernt liegt Chris blutend und schreiend am Boden. Ich will zu ihm laufen und ihm helfen. Da werde ich an meinen Hinterbeinen gepackt. Der Bauer. Er zieht mich nach oben und begutachtet mich. Ich habe Angst. Dann holt er eine Zange raus. Bevor ich mich wehren kann, macht es Klack. Mein kleiner Kringelschwanz ist ab. Ich schreie vor Schmerzen und trete um mich. Das Blut spritzt. Ich lande auf dem Boden. Überall das Blut. Der Bauer schnappt sich einen meiner Brüder, Pete. Klack. Der nächste Kringelschwanz ist ab. Jetzt holt er plötzlich ein Messer raus. Pete schreit wie verrückt und versucht zu entfliehen. Der Bauer nimmt das Messer und schneidet einen Schlitz zwischen Petes Hinterbeine. Dann nimmt er seine Hand und reißt ihm die Hoden mit bloßen Händen heraus. Ein lauter Schrei. Welch Glück, dass ich weiblich bin. Nachdem der Bauer die brutale Prozedur bei allen meinen Geschwistern durchgeführt hat, zieht er ab, als wäre nichts, aber auch gar nichts gewesen. Ich höre ihn sogar noch pfeifen. Zurück bleiben wir, voller Blut. Die Schmerzen sind kaum zu ertragen.
Am vierten Tag kommt der Bauer wieder. Er begutachtet uns. Plötzlich packt er sich Sandy. Er packt sie an den Hinterbeinen und holt aus. Sandy schreit um Hilfe und tritt um sich. Sie versucht zu entkommen. Doch der Bauer ist viel zu stark. Er donnert ihren Kopf mit voller Wucht gegen den Boden. Wieder und wieder. Danach wirft er sie in einen großen Eimer hinter sich. Nach dem zweiten Schlag hörte man keine Schreie mehr. Er schaut sich weiter um. Hilfe! Hoffentlich nimmt er nicht mich. Er sieht mich an und kommt auf mich zu. Er greift mich, lässt aber wieder von mir ab. Scheinbar hat er ein anderes Opfer gefunden. Er schnappt sich einen meiner anderen Brüder, Paul, und schlägt ihn wie Sandy einfach tot. Danach entsorgt er ihn ebenfalls in dem großen Eimer. Schließlich verschwindet er wieder, zusammen mit dem Eimer. Als wäre nichts gewesen. In der Ferne höre ich ihn wieder pfeifen.
Wir sind alle entsetzt. Dieser Bauer muss so was wie der Teufel sein. Aber was haben wir falsch gemacht? Wofür werden wir bestraft? Zumindest gibt es jetzt genügend Milch für uns. Allerdings nicht lange. Nach wenigen Tagen kommt der Bauer wieder, diesmal mit weiteren Helfern. Sie packen uns und bringen uns in eine enge Bucht. Unsere Mutter darf nicht mit. An diesem Tag hab ich sie das letzte Mal gesehen. Ich habe leider nie erfahren, was aus ihr geworden ist.
Wir sind jetzt zu zwölft in unserer 9 m² großen Bucht. Es stinkt. Es ist eng, und es ist dunkel. Dafür gibt es jetzt jede Menge zu essen. Allerdings jeden Tag denselben Brei. So geht das mehrere Wochen lang. Es gibt keine Toiletten oder ähnliches, wir müssen unsere Notdurft einfach in unserer Bucht verrichten. Daher auch der unerträgliche Gestank. Nicht mal einen anständigen Boden haben wir unter uns, überall sind Spalten. Sie sind wohl dazu da, dass unsere Scheiße dadurch verschwinden kann. Wenn wir schlafen wollen, müssen wir uns in unsere eigene Scheiße legen. Es ist widerlich.
Alle drei Tage kommt der Bauer vorbei und bringt uns eine Hand voll Stroh. Warum weiß ich nicht. Wirklich etwas damit anfangen können wir nicht. Es schmeckt auch nicht. Und es gibt weiterhin jeden Tag denselben Brei. Immer mal wieder schmeckt unser Essen anders als sonst. Als wäre etwas untergemischt. Ich fühle mich nicht gut, ich würde mich gerne mehr bewegen. Aber in diesem engen Raum kann ich das nicht. Deshalb liege ich meistens in der Ecke, zwischendurch esse ich. Und ich hoffe, dass all das irgendwann ein Ende hat.
So geht das mehrere Wochen lang. Nach drei Monaten geht es Chris sehr schlecht. Er klagt über furchtbare Schmerzen im Magen. Er liegt nur noch in der Ecke und regt sich kaum noch. Essen will er auch nicht mehr. Er hat auch schon richtig Gewicht verloren. Der Bauer kommt vorbei, heute ist er nicht allein. Er hat einen weiteren Mann in einem weißen Kittel dabei. Dieser begutachtet Chris. Die nächsten Tage schmeckt unser Essen wieder anders als sonst. Nachdem sich Chris seit gestern Abend gar nicht mehr bewegt hat, hat ihn der Bauer abgeholt. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Manchmal frage ich mich, wie es ihm ergangen ist.
Die Tage vergehen, wir wachsen und langweilen uns dabei zu Tode. Tagein tagaus dasselbe Essen, dieselbe Bucht, derselbe Bauer, derselbe Ablauf. Da wir immer größer werden, wird es von Tag zu Tag enger in unserer Bucht, wir können uns kaum noch bewegen.
Einige Wochen später, wir fühlen uns mittlerweile alle richtig träge und voll, kommt wieder der Bauer. Diesmal hat er wieder seine Helfer dabei. Der Bauer öffnet das Tor unserer Bucht. Zum ersten Mal seit Monaten dürfen wir diesen engen Ort verlassen. Wir sind alle ganz aufgeregt. Vielleicht hat der Wahnsinn endlich ein Ende, denke ich mir. Aber scheinbar wird es nicht besser: Man zwängt uns durch die Gänge, und wenn wir nicht schnell genug laufen, werden wir mit einem Stock geschlagen. Da ich mittlerweile so viel zugenommen habe, fällt es mir schwer, mich schnell zu bewegen. Meine Gelenke schmerzen bei jedem Schritt.
Wir verlassen die grauen Mauern. Ich hätte nicht gedacht, dass man da überhaupt rauskommen kann. Aber da ist ein großes Tor in einer der Wände, das ich bisher nicht sehen konnte. Außerhalb der Mauer ist plötzlich dieser stechende Gestank weg. Es ist zwar etwas kälter, aber es riecht viel besser – irgendwie frischer und sauberer. Die Farben sind überwältigend. Ich sehe grüne Wiesen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas Grünes sehe. Und über den Wiesen ist der Himmel, strahlend blau. Nie zuvor in meinem Leben habe ich etwas Blaues gesehen. Ich drehe mich um, und da sehe ich sie zum ersten Mal: ein goldener, warmer Fleck am Himmel – die Sonne. Ich spüre das Sonnenlicht auf meiner Haut, zum ersten Mal in meinem Leben. Es fühlt sich warm an, es gibt mir Kraft und Hoffnung. Heute scheint der beste Tag meines Lebens zu sein.
Ich will in Richtung der Wiese laufen, bekomme aber einen Schlag von einem der Helfer und gehe zu Boden. Wir werden alle in ein großes Fahrzeug mit Gittern an den Seiten getrieben. Es ist eng, fast noch enger als in unserer Bucht. Plötzlich beginnt sich der Boden unter uns zu bewegen – wir fahren. Und fahren. Und fahren. Wir schauen alle gespannt durch die Gitter nach draußen. Es ist alles neu für uns. Nach einigen Stunden bekomme ich furchtbaren Durst. Aber es gibt hier nichts zu trinken und nichts zu essen. Als das Fahrzeug hält, ist es schon fast dunkel. Mir ist schwindlig, ich brauche etwas zu trinken. Es ist geschafft, wir sind da. Jetzt kann alles nur noch besser werden.
Wir werden direkt in ein weiteres Gebäude gebracht. Es stinkt. Oh nein, denke ich mir. Ich hatte gerade begonnen, mich an die frische Luft zu gewöhnen. Zumindest ist der Boden hier schön warm. Wir stehen in einer langen Schlange in einem engen Gang. Immer wieder werden wir geschlagen damit wir weiter laufen. Ich höre Schreie. Ich bekomme Panik, und meine Geschwister auch. Wo kommen die Geräusche her? Und wer schreit da? Das kann nichts Gutes bedeuten. Wir wollen umdrehen. Aber die Gänge sind zu eng, wir können uns nicht einmal umdrehen. Von hinten kommen die Schläge. Es ist ausweglos, wir müssen immer weiter gehen. Wir werden um eine Kurve getrieben.
Jetzt sehe ich es. Am Ende des Gangs steht ein Mensch mit einer Zange. Damit geht er auf meine Geschwister los. Werden sie von der Zange getroffen, fallen sie um. Sie töten uns! Ich sehe, wie vor mir eines meiner Geschwister mit dem Bein an eine Art Förderanlage gekettet wird. Es regt sich nicht mehr. Vor ihm baumeln weitere leblose Körper. Sie bewegen sich – auf einen Mann zu, der mit einem Messer in der Hand auf sie wartet. Wenn sie ankommen, rammt er ihnen das Messer in den Hals. Und das Blut, überall Blut.
Ich will hier raus. Aber ich kann nicht. Von hinten drücken die anderen. Und vor mir wartet der blanke Horror. Der Mann kommt mit der Zange auf mich zu. An mehr kann ich mich nicht erinnern, ich muss ohnmächtig geworden sein. Als ich wieder zu mir komme, baumle auch ich kopfüber an einem Haken. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe keine Kraft. Von meinem Hals tropft Blut. Die Fördertechnik beginnt sich zu bewegen. Vor mir, hinter mir, überall meine Geschwister, blutverschmiert. In der Ferne sehe ich nur noch Hälften von Ihnen am Haken hängen. Wir kommen zu einem großen Becken. Ich verliere an Höhe. Die Anlage taucht mich unter Wasser. Das Wasser ist kochend heiß, die Schmerzen sind unerträglich. Ich bekomme keine Luft mehr. Ich will hier raus. Ich will hier raus! Dann wird es langsam dunkel.

"Für ein kleines Stück Fleisch nehmen wir den Tieren die Seele sowie Sonnenlicht und Lebenszeit, wozu sie doch entstanden und von Natur aus da sind."
Plutarch - (45 - 120) - Griechischer Schriftsteller